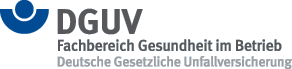
Handlungs- und Entscheidungsspielraum: Starre Arbeitsabläufe

Praxisbeispiel
Das Team eines Architekturbüros ist zuständig für unterschiedliche Projekte zu Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Im Rahmen der Projekte sind inhaltliche, zeitliche, finanzielle und personelle Planungen und Entscheidungen vorzunehmen, in Absprache mit den jeweiligen Kunden sowie Dienstleistern, oftmals unter Zeitdruck. In letzter Zeit häufen sich schwierige und unangenehme Situationen mit Kunden und Dienstleistern, da die Beschäftigten nicht flexibel und zeitnah genug auf An- und Rückfragen reagieren können.
Der Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Teammitglieder ist jedoch durch die festgelegten Prozesse im Betrieb (u. a. umfangreiche Dokumentationsnotwendigkeiten) sowie vorgeschriebene Rücksprachen mit dem Vorgesetzten und im Team stark eingeschränkt.
Einzelne Teammitglieder haben große Probleme, nach Feierabend von der Arbeit abzuschalten.

Mögliche Gefährdungen
Durch eingeschränkte Handlungs- und Entscheidungsspielräume kann insbesondere unter Druck nicht adäquat auf die Belastungssituation reagiert werden. Arbeiten unter Zeitdruck und mit einem nur geringen Tätigkeitsspiel kann u. a. zu Stress, Beeinträchtigungen des Befindens, Erschöpfungszuständen, Depression und Burnout führen. Ausreichende Handlungs- und Entscheidungsspielräume können hingegen Wohlbefinden, Leistung und Motivation fördern und Gesundheitsrisiken reduzieren.

Schutzziele
Es sollte ein ausreichend großer Handlungs- und Entscheidungsspielraum vorhanden sein, so dass die Arbeitsaufträge flexibel genug bearbeitet und die Arbeitsziele erreicht werden können. Dabei sollten bestehende Qualifikationen bei der Tätigkeitsausübung genutzt werden. Durch die Gestaltung des Tätigkeitsspielraums sollten Lernchancen gegeben sein und die Persönlichkeitsentwicklung in der Arbeit gefördert werden.

Beispielhafte Maßnahmen
In der Reihenfolge S-T-O-P soll geprüft werden, ob es passende Maßnahmen zum Schutz vor einer Gefährdung gibt.
Substitution
- In diesem Beispiel wurden keine substituierenden Maßnahmen getroffen.
Technische Maßnahmen
- Es wird ein IT-gestütztes Projekt- und Dokumentenmanagement auch hinsichtlich der Verwaltung und Abrechnung der Bauvorhaben installiert, mit dem neben den Architekten auch die Sachbearbeiterinnen und technischen Zeichnerinnen arbeiten.
Organisatorische Maßnahmen
- Die Dokumentationsvorgaben im Betrieb wurden überprüft. Unnötige oder sogar redundante Dokumentationen wurden abgeschafft, so dass für einzelne Arbeitsaufträge nun deutlich weniger Tabellen und Formulare auszufüllen sind.
- Es wurde eine Schnittstellenanalyse durchgeführt, in der (gegenseitige) Abhängigkeiten im Team sowie von Zuarbeiten anderer identifiziert und Probleme thematisiert wurden. Als Ergebnis wurden z. B. Abhängigkeiten reduziert und notwenige Reaktionszeiten für bestimmte Teilaufträge vereinbart.
- Die Genehmigungsprozesse im Betrieb wurden in Abstimmung mit den Vorgesetzten verschlankt, so dass die Sachbearbeiterin nun deutlich seltener Rücksprache mit ihren Vorgesetzten halten muss und flexibler reagieren kann.
Personenbezogene Maßnahmen
- Für das Team wird ein Verhandlungstraining und Kommunikationsseminar zum Thema Umgang mit schwierigen Kunden und Baufirmen durchgeführt. Zudem werden die nötigen Handlungsspielräume von den Beschäftigten gegenüber ihren Vorgesetzten stärker eingefordert.
- Die Beschäftigten werden zu neuen Bauvorhaben umfassend informiert und ggf. auch zum Kunden mitgenommen.

