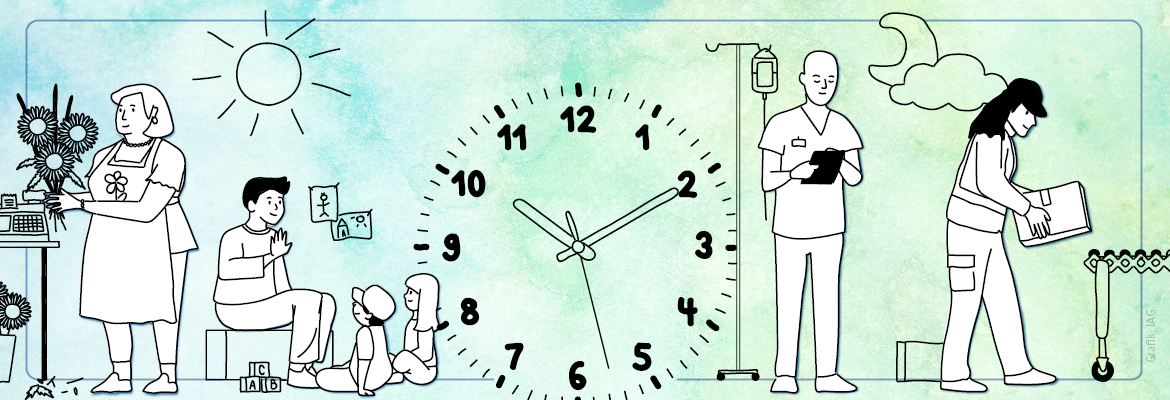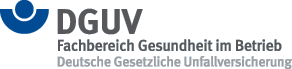
Erholungszeiten: Pausen

Praxisbeispiel
In einem Pflegeheim fällt es den Beschäftigten zunehmend schwer, Pausen zu nehmen. Durch Personalmangel, dem Wunsch, den Bewohnerbedürfnissen gerecht zu werden und dem damit verbundenen steigenden Arbeitsdruck fallen Pausen oft weg, werden verkürzt oder sind aufgrund von Unterbrechungen nicht erholsam. Zudem bemängeln einige Beschäftigte, dass sie die Pausen oft allein, und nicht gemeinsam mit dem Team, nehmen können.

Mögliche Gefährdungen
Arbeit ohne ausreichende Ruhepausen vergrößert den Arbeitsstress, erhöht die Unfallgefahr (z. B. Stolper-, Rutsch-, und Sturzunfälle) und gefährdet damit die Sicherheit der Beschäftigten. Durch den hohen Zeitdruck kann es auch häufiger zu Fehlern bei der Pflege kommen. Langfristig kann Arbeiten ohne Pausen zu einem erhöhten Risiko für Fehler- und Unfälle bzw. zu Erschöpfungszuständen führen. Die Arbeitszufriedenheit sinkt.

Schutzziele
Die Arbeit ist sicher und gesund gestaltet, wenn ausreichend störungsfreie Pausen- und Erholungszeiten sichergestellt sind. Das Arbeitszeitgesetz schreibt bei mehr als 6 Stunden Arbeitszeit Pausen von insgesamt mindestens 30 Minuten vor, bei mehr als 9 Stunden Arbeitszeit insgesamt mindestens 45 Minuten. Vorgesehen sind Pausen von mindestens 15 Minuten am Stück.
Eine klare Trennung von Pflegetätigkeit und Pausen ist sichergestellt.

Beispielhafte Maßnahmen
In der Reihenfolge S-T-O-P soll geprüft werden, ob es passende Maßnahmen zum Schutz vor einer Gefährdung gibt.
Substitution
- In diesem Beispiel wurden keine substituierenden Maßnahmen getroffen.
Technische Maßnahmen
- Angenehme und erholungsfördernd gestaltete Pausenräume stehen zur Verfügung (bequeme Sitzgelegenheiten, Lärmpegel bei maximal 55 dB(A), ausreichend Tageslicht). Dadurch wird vermieden, dass die Pause und die Mahlzeit am Arbeitsplatz erfolgt, und ein besseres Abschalten von der Arbeitstätigkeit ermöglicht.
- Es werden Bildschirmschoner mit Erinnerungsanzeigen für die Einhaltung von Pausenzeiten eingerichtet.
- Es besteht das Angebot kurzer digitaler Entspannungseinheiten während der Arbeitszeit, um den Einstieg in eine niederschwellige und gesundheitsförderliche Pausengestaltung zu ermöglichen.
Organisatorische Maßnahmen
- Pausensysteme werden optimiert. Zum Beispiel werden regelmäßige Pausen durch Festlegung von Pausengruppen, die einander wechselseitig vertreten, oder durch Springer sichergestellt. Dies beugt auch der Pausenunterbrechung vor.
- Zusammen mit den Beschäftigten werden Gründe für Pausenausfall ermittelt sowie Änderungen der Pausenorganisation geplant und umgesetzt.
- Die Beschäftigten werden bei der Gestaltung der Pausenräume eingebunden, um diese möglichst angenehm und erholungsfördernd zu gestalten.
- Nach emotionalen, körperlichen und kognitiv herausfordernden Tätigkeiten sind Kurzpausen für die Erholung ermöglicht.
- Arbeitspausen sind vorhersehbar, Lage und Dauer stehen zu Arbeitsbeginn fest. Der Zeitpunkt der Pausen kann entsprechend den individuellen Bedürfnissen gewählt werden.
- Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und gestalten durch ihr Verhalten eine gesunde Pausenkultur mit.
Personenbezogene Maßnahmen
- Bei vorwiegend körperlich fordernden Tätigkeiten werden passive Pausen genutzt.
- Regelmäßige Kurzpausen von 3 bis 5 Minuten werden durchgeführt – noch bevor Ermüdungserscheinungen spürbar sind.
- Beschäftigte werden über die gesetzliche Pflicht zur Pause sowie die Wichtigkeit von Erholung für Gesundheit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit geschult. Sie reflektieren das eigene Pausenverhalten und achten auf ihre eigenen Leistungsgrenzen.
- Gespräche über Arbeitsthemen werden in der Pause vermieden, um das Abschalten zu ermöglichen.